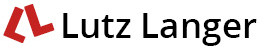Gesundes Raumklima in Kita und Grundschule
Ein gutes Raumklima, weder stickig noch zu kalt, ist für die Konzentration, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Mitarbeitenden essenziell wichtig. Die aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz bringen aber gleichzeitig neue Herausforderungen mit sich: Wie sorgt man für ausreichende Frischluft, ohne hinterher die Heizkosten explodieren zu lassen? Und wie erkennt man überhaupt, wann gelüftet werden muss?
In diesem Beitrag erfahren Sie:
1. Warum Raumklima mehr ist als eine reine Temperatur
2. Wie CO₂ als Indikator für Luftqualität dient
3. Praktische Lüftungskonzepte für jeden Raumtyp
4. Energiesparende Heizstrategien ohne Komfortverlust
5. Die Rolle von CO₂-Ampeln und smarten Sensoren
6. Tipps für Schulsekretariat und Hausmeister
7. Ein Best-Practice-Beispiel
8. Checkliste & Ausblick
Wir bleiben dabei praxisnah und vermeiden technisches Fachchinesisch.
Mehr als nur „warme Luft“: Warum das Raumklima entscheidend ist
Nach wenigen Schulstunden fühlen sich Klassen- und Gruppenräume bereits schwül und stickig an. Die Konzentrationsfähigkeit junger Schüler und Kinder sinkt dabei nachweislich, da der CO₂-Gehalt in der Luft auf über 1 000 ppm (parts per million) steigt. Gleichzeitig nimmt dabei das Risiko von Erkältungen, Kopfschmerzen und Gereiztheit zu. Ein ausgewogenes Raumklima• unterstützt die Lernleistung (weniger Fehler, bessere Aufmerksamkeit),
• beugt Erkrankungen vor (Tröpfcheninfektionen werden durch Frischluft reduziert),
• steigert das Wohlbefinden aller Anwesenden.
Dabei sollte nicht nur allein aus Gesundheitsgründen gelüftet werden. Angesichts der Energiepreisentwicklung ist es nämlich ebenso wichtig, Heizenergie effizient einzusetzen und unnötiges Auskühlen zu verhindern. Ein modernes Raumklimamanagement vereinbart Wohlbefinden und Wirtschaftlichkeit miteinander.
Interessante Produkte zum Thema
CO₂ als Schlüsselindikator: Warum wir nicht auf unser Bauchgefühl vertrauen sollten
Subjektive Signale wie das Lüften nach „Hände ans Fenster“ oder „es zieht“? helfen leider wenig. Stattdessen empfiehlt sich hier der Blick auf die CO₂-Konzentration, da sie mit Atmungsprozessen und Luftaustausch korreliert. Pro Person und pro Stunde steigt in geschlossenen Räumen der CO₂-Wert um 200–300 ppm, wenn nicht gelüftet wird.Hier eine kurze Übersicht über die Werte:
• 400–1 000 ppm: Frische Luft, Konzentration optimal
• 1 000–1 500 ppm: leicht müde, erste Konzentrationseinbußen
• > 1 500 ppm: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Atemnot, erhöhte Infektionsgefahr
Deshalb sollten Sie sich nicht nur auf mündliche Beschwerden verlassen, da diese oft schon zu spät kommen. CO₂-Ampeln sind eine gute Möglichkeit, da sie in Echtzeit zeigen, wann das Lüften zwingend ist. Ob farbige LEDs (grün–gelb–rot) oder digitale Werteanzeigen. Moderne Geräte helfen Ihnen dabei, den richtigen Moment nicht zu verpassen.
Lüftungskonzepte für jeden Raumtyp
Kurzes Stoßlüften vs. Kipplüften
Weit verbreitet, aber eher ineffizient ist das dauerhafte Kippen der Fenster. Besser sind 5–7 Minuten Stoßlüften (alle Fenster und Türen weit öffnen), danach vollständig schließen. So tauscht sich die Luft schnell aus, ohne dass dabei die Wände auskühlen.
Dies gilt natürlich vor allem für die kalten Jahreszeiten.
Praxis-Tipp für Lehrerkräfte: Nach jeder Unterrichtsstunde oder spätestens alle 45 Minuten sollte das Stoßlüften eingeplant werden. Ein akustischer Timer oder eine CO₂-Ampel kann dabei helfen, den Zeitpunkt nicht zu verpassen.
Querlüften vs. Kreuzlüften
• Kreuzlüften: Parallelfenster im selben Raum öffnen.
• Querlüften: Fenster in gegenüberliegenden Räumen oder Korridoren öffnen.
Beide Methoden sind wirksam. Die Wahl richtet sich nach der Raumarchitektur. Querlüften erreicht oft mehr Luftwechsel, benötigt aber klare Absprachen mit benachbarten Lehrkräften.
Mechanische Lüftung & CO₂-gesteuerte Fensteröffner
In Neubauten und in sanierten Gebäuden kommen inzwischen zunehmend lüftungstechnische Anlagen zum Einsatz. Moderne sensorgesteuerte Fensteröffner ermöglichen das automatische Lüften bei einem überschrittenem CO₂-Wert. Dies ist ideal, um Pausen freizuhalten und Lehrkräften zusätzliche Arbeit abzunehmen.
Heizen mit Köpfchen: Komfortabel und energieeffizient
Frieren macht keinen Spaß und offene Fenster bei Minusgraden sind Energiefresser. Mit diesen einfachen Maßnahmen lässt sich aber beides miteinander vermeiden:1. Heizkörper freihalten: Möbelstücke und Vorhänge mindern die Wärmeleistung um bis zu 15 %. Ein Abstand von 10 cm ist optimal.
2. Thermostatventile richtig einstellen: Stufe 3 (ca. 20 °C) für Aufenthaltsräume, Stufe 2 (ca. 16–17 °C) für Flure. Nie voll aufdrehen, denn das drosselt nur den Wärmefluss und kostet viel Energie.
3. Nachtabsenkung in den Ferien und am Wochenende: 15 °C reichen, um Schimmelbildung zu verhindern und Heizkosten zu sparen.
4. Wärmedämmende Vorhänge oder Fensterfolien: Besonders in Altbauten mit doppelschaligem Mauerwerk reduzieren sie den Wärmestrom.
Eine enge Abstimmung zwischen Lehrkräften und Hausmeisterteam stellt sicher, dass die Temperatur optimal und einheitlich eingestellt bleibt. Das Schulsekretariat und die Schulleitung sollten ein Schema für die Heizzyklen und die Nachtabsenkung festlegen.
CO₂-Ampeln und smarte Sensoren: Die Augen fürs Raumklima
Eine CO₂-Ampel allein reicht oft schon, um zur rechten Zeit zu lüften. Doch moderne Sensoren bieten noch mehr:• Temperatur- und Feuchtemessung ergänzen die CO₂-Daten zu einem ganzheitlichen Bild.
• Datenprotokollierung per USB oder WLAN ermöglichen eine langfristige Auswertung von Raumklima-Trends.
• Alarmfunktionen per Push-Nachricht an Lehrkräfte oder Hausmeister.
Beispiele für sinnvolle Anschaffungen:
• Basis-Ampel mit dreifarbiger LED-Anzeige
• Profi-Sensor mit App und webbasierter Auswertungsplattform
• Funkvernetztes System für mehrere Räume, ideal für Ganztagsschulen und große Kitas
Rollenverteilung: Wer kümmert sich um was?
Ein gutes Raumklimamanagement ist Teamarbeit:Lehrkräfte / Erzieher
• Stoßlüften im Stundenplan verankern
• CO₂-Ampel im Blick behalten
• Temperatur- und Feuchtewerte notieren bei Bedarf
Sekretariat
• Anschaffung und Verteilung der Ampeln koordinieren
• Schulungstermine für Mitarbeitende organisieren
• Wartungsintervalle für Geräte einplanen
Hausmeister
• Thermostatventile prüfen und justieren
• Fenster- und Türdichtungen kontrollieren
• Mechanische Lüftungsanlagen warten
Idealerweise gibt es einen Raumklima-Beauftragten pro Einrichtung, der zwischen allen Gruppen vermittelt und für regelmäßige Kontrollen sorgt.
Praxisbeispiel: Die Grundschule Eichenweg
An der Grundschule Eichenweg (24 Klassenräume, offene Ganztagsschule) wurde 2024 ein Pilotprojekt zum Raumklima gestartet.1. Ausgangslage: Häufig wurde das Lüften vergessen oder nicht Ernst genommen, wodurch die Klassenräume oft zu feucht (über 65 % r.F.) waren.
2. Maßnahmen:
a. Ausstattung aller Klassen mit CO₂-Ampeln
b. Schulung für Lehrkräfte: Lüftungsintervalle im Stundenplan verankern
c. Hausmeister justierte Thermostatventile auf einheitliche Stufe 3
d. Pilotierung einer mechanischen Lüftungsanlage mit automatischen Fensteröffnern in drei Räumen
3. Ergebnisse nach drei Monaten:
a. Durchschnittlicher CO₂-Wert sank von 1 300 ppm auf 850 ppm
b. Heizkosten blieben im Vergleichszeitraum stabil, da Stoßlüften präziser erfolgte
c. Zufriedenheit unter Lehrkräften und Eltern stieg um 25 % (interne Umfrage)
Das Projekt wird 2025 auf alle Räume ausgeweitet und als Schulungsmodul für angehende Lehrkräfte in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule genutzt.
Checkliste für ein gesundes Raumklima
• CO₂-Ampeln im Klassen- und Gruppenraum installieren• Schulung zu Stoß- und Querlüften für alle Mitarbeitenden anbieten
• Thermostatventile auf optimale Stufe einstellen
• Mechanische Lüftungstechnik oder Fensteröffner prüfen
• Raumklima-Beauftragten benennen
• Protokollvorlagen für CO₂, Temperatur & Luftfeuchte erstellen
• Wartungs- und Kalibrierungsintervalle für Sensoren festlegen
FAQ zum Raumklima in der Schule & Kita
Muss ich bei Minusgraden trotzdem lüften?Ja. Stoßlüften gelingt auch in der kalten Jahreszeit in 3–5 Minuten, ohne dass Wände stark auskühlen.
Wie erkenne ich Schimmelgefahr?
Wenn sich Feuchtewerte über 65 % regelmäßig messen lassen. Schimmel entsteht meist in Ecken. Vermeiden Sie außerdem das Dauerkippen.
Wo platziere ich die CO₂-Ampel?
Auf Schultischhöhe (ca. 1,2 m) und nicht in Fensternähe, damit das Gerät repräsentative Werte erfassen kann.
Wer übernimmt die Kosten?
Förderprogramme für Schulen (Digitalpakt Kultur und Bildung) und kommunale Wohnungsbaugesellschaften unterstützen oft die Anschaffung.
Wie oft kalibrieren?
Hersteller empfehlen jährliche Kalibrierun. Prüfen Sie die technischen Spezifikationen.
Ausblick: Smarte Gebäude und KI-gestützte Regelung
Die Zukunft wird wahrscheinlich von smart vernetzten Gebäuden geprägt sein: Dabei erfassen Sensoren nicht nur CO₂, sondern auch Temperatur, Luftfeuchte, Feinstaub und Bewegung. KI-gesteuerte Lüftungs- und Heizsysteme sind dann so programmiert, dass sie vollautomatisch, basierend auf Stundenplan, Wetterprognosen und Nutzerzahlen regulieren. Für den Schul- und Kitabetrieb bedeutet das:• Mehr Komfort durch präzise Klimatisierung
• Energiereporting in Echtzeit
• Entlastung von Lehrkräften und Hausmeisterteam
Bis das aber flächendeckend Realität werden sollte, führen auch CO₂-Ampeln, klare Lüftungsregeln und effizientes Heizen zum gewünschten Ziel. Ein gesundes Raumklima, in dem Kinder und Mitarbeitende lernen und arbeiten können, ohne ständig über Luftqualität oder Heizkosten nachzudenken.
Fazit
Ein gutes Raumklima ist für den Alltag in Schulen und Kitas unverzichtbar. Mit einfachen Lüftungskonzepten, bedarfsgeführtem Heizen und dem Einsatz von CO₂-Ampeln schaffen Sie eine Atmosphäre, die Lernen, Gesundheit und Energieeffizienz miteinander vereint. Wenn Lehrkräfte, Sekretariat und Hausmeister dabei an einem Strang ziehen, halten Sie Wohlbefinden und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen im grünen Bereich. Packen wir es also gemeinsam an, damit frische Luft, angenehme Wärme und beste Lernbedingungen in Schulen und Kitas selbstverständlich werden.Helena H.. 27.06.2025
Das könnte Sie auch interessieren